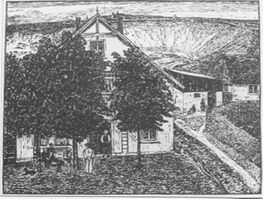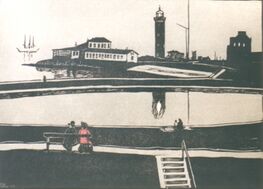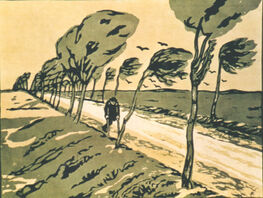Laage, Wilhelm: Unterschied zwischen den Versionen
Matze (Diskussion | Beiträge) |
Alina (Diskussion | Beiträge) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ‚àí | '''Wilhelm Laage''' (* [[16. Mai]] [[1868]] in Stellingen/Hamburg; ‚ÄÝ [[3. Januar]] [[1930]] Ulm) war | + | [[Datei:Wilhelm-Laage.jpg|Wilhelm Laage<br>Quelle:"Wilhelm Laage - Das graphische Werk" von A.Hagenlocher|thumb|right]] |
| + | '''Wilhelm Laage''' (* [[16. Mai]] [[1868]] in Stellingen/Hamburg; ‚ÄÝ [[3. Januar]] [[1930]] Ulm) war bildender K√ºnstler der [[Malerkolonie]] in [[Duhnen]]. | ||
| ‚àí | |||
| ‚àí | + | ||
| + | Laages Vater war der Friedhofsgärtner und Totengräber Heinrich Christian Friedrich Laage (Niendorf 15.11.1833 - Hamburg-Stellingen 16.12.1895), seit dem 30.11.1862 verheiratet mit Friederike Elsabe Krohn (Stellingen 05.12.1836-Stellingen 27.12.1913), die eine Hamburger Bleicherei betrieb. Der Ehe entstammten drei Kinder: Wilhelm Friedrich; Anna Magdalena (Stellingen 03.08.1870-Hamburg 02.06.1937), seit dem 09.07.1898 verheiratet mit Johann Heinrich Joseph | ||
| + | Brockmüller (geb. Brunsdorf 03.10.1871-Hamburg 27.05.1952); Carl Georg (geb.Stellingen 08.04.1874). | ||
| + | |||
| + | Nach der 1883 erfolgten Schulentlassung arbeitete Wilhelm Laage kurzzeitig in der Bleicherei der Mutter in Hamburg, war jedoch körperlich nicht in der Lage, die harte Arbeit durchzustehen. Er und verließ deshalb mit Einverständnis seiner Mutter die ungeliebte Stätte, um sich bis 1890 als Hausbursche in einem Hamburger Wirtshausbetrieb zu verdingen. | ||
| + | |||
| + | Mit Unterstützung und Förderung des Stellinger Pastors Peterssen, der die künstlerische Begabung Laages erkannt hatte, folgte der Besuch der Hamburger Gewerbeschule 1890-1892. Diese Ausbildung sollte für den talentierten Laage von | ||
| + | entscheidender Bedeutung werden, denn der seit Oktober 1886 als Direktor der Hamburger Kunsthalle wirkende Alfred Lichtwark (14.11.1852-13.01.1914) wurde auf Laage aufmerksam. 1893 gelangte Laage durch Lichtwarks Fürsprache an die | ||
| + | Großherzogliche Badische Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, wo er zunächst Schüler in der Gipsklasse von Prof. Robert Poetzelberger (1856-1930) wurde, ab 1895 Schüler von Prof. Leopold Graf von Kalckreuth (1855-1928) und | ||
| + | [[Grethe, Carlos|Prof. Carlos Grethe]]. | ||
| + | |||
| + | Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich, bedingt durch die zivilisatorische Entwicklung, in der bildenden Kunst eine Aufbruchstimmung. In deren Verlauf entstanden an zahlreichen Orten Künstlerkolonien, deren Verdienst es war, die in Konventionen erstarrte Malerei in das ungebrochene, freie Licht der Natur zurückgeführt zu haben. | ||
| + | |||
| + | Wilhelm Laage erfuhr auf Betreiben fortschrittlicher Karlsruher Lehrkräfte (Kalckreuth, Grethe, [[Schönleber, Gustav|Schönleber]]) in der 1895 in [[Duhnen]] und [[Altenwalde]] gegründeten Malerkolonie entscheidende Anregungen in | ||
| + | der Landschaftsauffassung. Auch der Beginn seines graphischen Schaffens fällt in das Jahr 1896, wobei zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt war, ob das Pendel in Richtung Holzschnitt oder Steindruck ausschlagen würde. | ||
| + | |||
| + | Für Laage blieb schließlich die lithographische Technik relativ bedeutungslos, hatte sich doch die Erkenntnis durchgesetzt, sich vor allem über den Holzschnitt künstlerisch optimal ausdrücken zu können. Frühzeitig verband ihn eine enge Freundschaft mit Emil Rudolf Weiß und Karl Hofer. | ||
| + | |||
| + | Nach schweren künstlerischen Auseinandersetzungen an der Karlsruher Akademie wechselten die Professoren Kalckreuth, Grethe und Poetzelberger 1899 an die Stuttgarter Akademie, was Laage veranlasste, ebenfalls nach Stuttgart zu wechseln, um dort bis 1904 ein Meisteratelier bei Leopold von Kalckreuth zu beziehen. Gleichzeitig unternahm der Künstler alljährliche Studienreisen an die Niederelbe nach Cuxhaven, Duhnen, Altenwalde, [[Altenbruch]] sowie auf die Watteninsel [[Neuwerk]]. | ||
| + | |||
| + | 1899 erschien die von Friedrich Dörnhöffer abgefasste erste Veröffentlichung über die Graphik W. Laages in der Wiener Zeitschrift „Die Graphischen Künste“. Von Dezember 1900 bis Mai 1901 hielt sich der Künstler in Paris auf, wo er in der Rue Leclercs ein Atelier betrieb. Hier erlebte er die erste große Van-Gogh-Ausstellung bei Bernheim (Paris). 1901 wurde sein in Paris entstandenes Bild „Die Heide“ in der Oldenburger Ausstellung mit der silbernen Medaille ausgezeichnet. | ||
| + | |||
| + | Sein Kommilitone Emil Rudolf Weiß veröffentlichte ebenfalls 1901 einen Beitrag über Laage in der Zeitschrift „Ver Sacrum“. Im Sommer 1902 hielt er sich wieder gemeinsam mit Karl Hofer in Altenwalde und Cuxhaven auf. 1903 wurden deutsche Galerien zunehmend auf den Holzschneider aufmerksam, und Karl Ernst Osthaus kaufte seine Arbeiten für das Folkwang-Museum in Hagen an. | ||
| + | |||
| + | Am 19.05.1904 heiratete Laage in Reutlingen die Malerin Hedwig Maria Kurtz (1877-1935), die er im Februar 1903 in Stuttgart kennen gelernt hatte. Seit dem 2. Juni 1904 waren die frisch Vermählten laut Einwohnerregister des Amtes Ritzebüttel Bürger von Cuxhaven, wohnhaft am [[Westerwischweg]] Nr. 16. Der mehrjährige Aufenthalt in Cuxhaven war von erheblicher Bedeutung, denn bereits im Jahre 1905 besuchte ihn der Hamburger Landgerichtsdirektor, bekannte Kunstsammler und Kunstmäzen Gustav Schiefler in Cuxhaven, der seinerzeit zu den bekanntesten Sammlern deutscher expressionistischer Graphik zählte. Er war es auch, der 1912 den ersten Oeuvre-Katalog „Das graphische Werk Wilhelm Laages bis 1912“ veröffentlichte. In der Folge dieses Besuches war Laage häufiger Gast im Hause von Schiefler in Mellingstedt (Hamburg), wo Künstler wie Schmidt-Rottluff, Nolde, Munch oder Heckel gern gesehene Gäste waren. | ||
| + | |||
| + | Am 01.06.1905 wurde das einzige Kind, der Sohn Friedrich, in Cuxhaven geboren (gest. 30.09.1940 Sonnenstein bei Dresden). | ||
| + | |||
| + | 1906 beteiligte sich Laage an der Ausstellung in Weimar, im September d. J. bei Commeter in Hamburg und im Dezember als Gast mit Kandinsky, H. Neumann und G. Hentze an der bedeutsamen Graphik-Ausstellung der Künstlergemeinschaft | ||
| + | „Brücke“ in Dresden. 1907 besuchte Karl Schmidt-Rottluff Familie Laage in Cuxhaven. Am 11. September (1907) erfolgte aus gesundheitlichen Gründen die Übersiedlung nach Betzingen bei Reutlingen. Wenige Wochen später wurden seine | ||
| + | Holzschnitte in Zürich präsentiert. Ab 1908 folgten weitere regelmäßige Sommeraufenthalte in Cuxhaven, die durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges unterbrochen wurden. In dieser Zeit Ausstellungsbeteiligungen in Bremen sowie in | ||
| + | Berlin (Große Berliner Kunstausstellung). 1910 Beteiligung an der Künstlerbund-Ausstellung in Darmstadt; Ankäufe durch die Hamburger Kunsthalle. 1911 war Laage auf der Internationalen Kunstausstellung in Rom vertreten, 1913 folgten Aufenthalte in der Schweiz und in Berlin. | ||
| + | |||
| + | Das künstlerisch erfolgreichste Jahr war 1914. Laage besucht Paris, Antwerpen und Graubünden, darüber hinaus wurde ihm der Villa-Romana-Preis Florenz verliehen, außerdem der Ehrenpreis der Stadt Leipzig und die Staatsmedaille auf der Internationalen Graphik-Ausstellung (ebenfalls in Leipzig). | ||
| + | |||
| + | Nach dem Ende des 1. Weltkrieges folgten ab 1919 wieder regelmäßige Malaufenthalte in Cuxhaven und Altenwalde. Seine letzten Arbeiten als Holzschneider schuf Laage im Jahre 1924. | ||
| + | |||
| + | Nach heutigem Kenntnisstand umfasst sein graphisches Werk 438 Blätter, davon 417 Holzschnitte. Die letzte Atelierausstellung fand im Spätherbst 1929 statt. Am 03.01.1930 starb Laage in Ulm beim Aufbau einer Ausstellung seiner Arbeiten. Beigesetzt wurde er in Reutlingen, wo am 15.01.1945 die Grabstätte durch Bomben vernichtet wurde. | ||
| + | |||
| + | Das gesamte Frühwerk (bis 1913/14) dieses bedeutenden deutschen Frühexpressionisten, der schon unter seines Zeitgenossen als Erneuerer des Holzschnitts galt, wurzelt an der Elbmündung. Sein Schaffen als Holzschneider ist | ||
| + | eng verknüpft mit dem Aufbruch in die Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts. | ||
| + | |||
| + | 1987 wurde im Cuxhavener Ortsteil Duhnen der [[Wilhelm-Laage-Weg]] nach diesem bedeutenden deutschen Frühexpressionisten benannt. | ||
| + | |||
| + | In der Kunstsammlung der Stadt Reutlingen (Städtisches Kunstmuseum Spendhaus) bilden die Arbeiten Laages auf dem Sammlungsgebiet des Holzschnitts der klassischen Moderne einen Schwerpunkt. Die meisten Kupferstichkabinette in | ||
| + | Deutschland haben die Arbeiten Laages in ihren Bestand aufgenommen. Ein Großteil des Nachlasses befindet sich in Reutlinger Privatbesitz. Angesichts der Bedeutung Laages für die Stadt Cuxhaven wurde im Juni 2002 erneut eine große Laage-Ausstellung eröffnet (überwiegend Holzschnitte), die der Cuxhavener Heimatforscher, Autor und Kunstsammler Peter Bussler initiiert hatte. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Bilder== | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="4"> | ||
| + | |||
| + | Datei:Die Maler beim Fachsimpeln in Altenbruch.jpg|Die_Maler beim Fachsimpeln in [[Altenbruch]] 1899.<br>Von links_[[Matthaei, Karl Otto|K._O._Matthaei]], [[Laage, Wilhelm|Wilhelm Laage]],_[[Euler, Eduard|Eduard Euler]], [[Mißfeldt, Friedrich|Friedrich Mißfeldt]] | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Werke== | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="263" heights="225" perrow="4"> | ||
| + | Datei:Laage 004.jpg|Holzschnitt "Häuser am Deich" | ||
| + | Datei:Laage 003.jpg|Holzschnitt "Abenddämmerung" | ||
| + | Datei:Laage 002.jpg|Farbholzschnitt "Duhner Strand"" | ||
| + | Datei:Abschied von der Heide.jpg|Abschied von der Heide | ||
| + | Datei:Dorfwirtshaus in Altenwalde.jpg|Dorfwirtshaus in [[Altenwalde]] | ||
| + | Datei:Sonnenuntergang im Herbst in Cuxhaven.jpg|Sonnenuntergang im Herbst in Cuxhaven | ||
| + | Datei:Mann und Weib.jpg|Mann und Weib | ||
| + | Datei:Mergelkuhlen in der Altenwalder Heide.jpg|Mergelkuhlen in der Altenwalder Heide | ||
| + | Datei:Die Landstraße in Altenwalde.jpg|Die Landstraße in Altenwalde | ||
| + | Datei:Durch die Heide Lithographie.jpg|Durch die Heide | ||
| + | Datei:Daemmerung Holzschnitt.jpg|Dämmerung | ||
| + | Datei:Altenwalder Kirche oel auf Lwd.jpg|[[Kreuzkirche|Altenwalder Kirche]] | ||
| + | Datei:Am Anleger in Cuxhaven.jpg|Am Anleger in Cuxhaven | ||
| + | Datei:Am Heiderand.jpg|Am Heiderand | ||
| + | Datei:An der Elbmuendung.jpg|An der Elbmündung | ||
| + | Datei:Einsame Landstraße nach Altenwalde.jpg|Einsame Landstraße nach Altenwalde | ||
| + | Datei:In der Altenwalder Heide.jpg|In der Altenwalder Heide | ||
| + | Datei:Laage Leuchtturm Cuxhaven.jpg|[[Leuchtturm an der Alten Liebe|Leuchtturm Cuxhaven]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Weblink== | ||
| + | [http://wilhelm.laage.de/ Wilhelm Laage] | ||
[[Kategorie:Personen(Chronik)]] | [[Kategorie:Personen(Chronik)]] | ||
| + | [[Kategorie: Bildende Kunst]] | ||
| + | [[Kategorie:Kunstmaler]] | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2025, 13:03 Uhr
Wilhelm Laage (* 16. Mai 1868 in Stellingen/Hamburg; ‚ÄÝ 3. Januar 1930 Ulm) war bildender K√ºnstler der Malerkolonie in Duhnen.
Laages Vater war der Friedhofsgärtner und Totengräber Heinrich Christian Friedrich Laage (Niendorf 15.11.1833 - Hamburg-Stellingen 16.12.1895), seit dem 30.11.1862 verheiratet mit Friederike Elsabe Krohn (Stellingen 05.12.1836-Stellingen 27.12.1913), die eine Hamburger Bleicherei betrieb. Der Ehe entstammten drei Kinder: Wilhelm Friedrich; Anna Magdalena (Stellingen 03.08.1870-Hamburg 02.06.1937), seit dem 09.07.1898 verheiratet mit Johann Heinrich Joseph Brockmüller (geb. Brunsdorf 03.10.1871-Hamburg 27.05.1952); Carl Georg (geb.Stellingen 08.04.1874).
Nach der 1883 erfolgten Schulentlassung arbeitete Wilhelm Laage kurzzeitig in der Bleicherei der Mutter in Hamburg, war jedoch körperlich nicht in der Lage, die harte Arbeit durchzustehen. Er und verließ deshalb mit Einverständnis seiner Mutter die ungeliebte Stätte, um sich bis 1890 als Hausbursche in einem Hamburger Wirtshausbetrieb zu verdingen.
Mit Unterstützung und Förderung des Stellinger Pastors Peterssen, der die künstlerische Begabung Laages erkannt hatte, folgte der Besuch der Hamburger Gewerbeschule 1890-1892. Diese Ausbildung sollte für den talentierten Laage von entscheidender Bedeutung werden, denn der seit Oktober 1886 als Direktor der Hamburger Kunsthalle wirkende Alfred Lichtwark (14.11.1852-13.01.1914) wurde auf Laage aufmerksam. 1893 gelangte Laage durch Lichtwarks Fürsprache an die Großherzogliche Badische Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, wo er zunächst Schüler in der Gipsklasse von Prof. Robert Poetzelberger (1856-1930) wurde, ab 1895 Schüler von Prof. Leopold Graf von Kalckreuth (1855-1928) und Prof. Carlos Grethe.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich, bedingt durch die zivilisatorische Entwicklung, in der bildenden Kunst eine Aufbruchstimmung. In deren Verlauf entstanden an zahlreichen Orten Künstlerkolonien, deren Verdienst es war, die in Konventionen erstarrte Malerei in das ungebrochene, freie Licht der Natur zurückgeführt zu haben.
Wilhelm Laage erfuhr auf Betreiben fortschrittlicher Karlsruher Lehrkräfte (Kalckreuth, Grethe, Schönleber) in der 1895 in Duhnen und Altenwalde gegründeten Malerkolonie entscheidende Anregungen in der Landschaftsauffassung. Auch der Beginn seines graphischen Schaffens fällt in das Jahr 1896, wobei zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt war, ob das Pendel in Richtung Holzschnitt oder Steindruck ausschlagen würde.
Für Laage blieb schließlich die lithographische Technik relativ bedeutungslos, hatte sich doch die Erkenntnis durchgesetzt, sich vor allem über den Holzschnitt künstlerisch optimal ausdrücken zu können. Frühzeitig verband ihn eine enge Freundschaft mit Emil Rudolf Weiß und Karl Hofer.
Nach schweren künstlerischen Auseinandersetzungen an der Karlsruher Akademie wechselten die Professoren Kalckreuth, Grethe und Poetzelberger 1899 an die Stuttgarter Akademie, was Laage veranlasste, ebenfalls nach Stuttgart zu wechseln, um dort bis 1904 ein Meisteratelier bei Leopold von Kalckreuth zu beziehen. Gleichzeitig unternahm der Künstler alljährliche Studienreisen an die Niederelbe nach Cuxhaven, Duhnen, Altenwalde, Altenbruch sowie auf die Watteninsel Neuwerk.
1899 erschien die von Friedrich Dörnhöffer abgefasste erste Veröffentlichung über die Graphik W. Laages in der Wiener Zeitschrift „Die Graphischen Künste“. Von Dezember 1900 bis Mai 1901 hielt sich der Künstler in Paris auf, wo er in der Rue Leclercs ein Atelier betrieb. Hier erlebte er die erste große Van-Gogh-Ausstellung bei Bernheim (Paris). 1901 wurde sein in Paris entstandenes Bild „Die Heide“ in der Oldenburger Ausstellung mit der silbernen Medaille ausgezeichnet.
Sein Kommilitone Emil Rudolf Weiß veröffentlichte ebenfalls 1901 einen Beitrag über Laage in der Zeitschrift „Ver Sacrum“. Im Sommer 1902 hielt er sich wieder gemeinsam mit Karl Hofer in Altenwalde und Cuxhaven auf. 1903 wurden deutsche Galerien zunehmend auf den Holzschneider aufmerksam, und Karl Ernst Osthaus kaufte seine Arbeiten für das Folkwang-Museum in Hagen an.
Am 19.05.1904 heiratete Laage in Reutlingen die Malerin Hedwig Maria Kurtz (1877-1935), die er im Februar 1903 in Stuttgart kennen gelernt hatte. Seit dem 2. Juni 1904 waren die frisch Vermählten laut Einwohnerregister des Amtes Ritzebüttel Bürger von Cuxhaven, wohnhaft am Westerwischweg Nr. 16. Der mehrjährige Aufenthalt in Cuxhaven war von erheblicher Bedeutung, denn bereits im Jahre 1905 besuchte ihn der Hamburger Landgerichtsdirektor, bekannte Kunstsammler und Kunstmäzen Gustav Schiefler in Cuxhaven, der seinerzeit zu den bekanntesten Sammlern deutscher expressionistischer Graphik zählte. Er war es auch, der 1912 den ersten Oeuvre-Katalog „Das graphische Werk Wilhelm Laages bis 1912“ veröffentlichte. In der Folge dieses Besuches war Laage häufiger Gast im Hause von Schiefler in Mellingstedt (Hamburg), wo Künstler wie Schmidt-Rottluff, Nolde, Munch oder Heckel gern gesehene Gäste waren.
Am 01.06.1905 wurde das einzige Kind, der Sohn Friedrich, in Cuxhaven geboren (gest. 30.09.1940 Sonnenstein bei Dresden).
1906 beteiligte sich Laage an der Ausstellung in Weimar, im September d. J. bei Commeter in Hamburg und im Dezember als Gast mit Kandinsky, H. Neumann und G. Hentze an der bedeutsamen Graphik-Ausstellung der Künstlergemeinschaft „Brücke“ in Dresden. 1907 besuchte Karl Schmidt-Rottluff Familie Laage in Cuxhaven. Am 11. September (1907) erfolgte aus gesundheitlichen Gründen die Übersiedlung nach Betzingen bei Reutlingen. Wenige Wochen später wurden seine Holzschnitte in Zürich präsentiert. Ab 1908 folgten weitere regelmäßige Sommeraufenthalte in Cuxhaven, die durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges unterbrochen wurden. In dieser Zeit Ausstellungsbeteiligungen in Bremen sowie in Berlin (Große Berliner Kunstausstellung). 1910 Beteiligung an der Künstlerbund-Ausstellung in Darmstadt; Ankäufe durch die Hamburger Kunsthalle. 1911 war Laage auf der Internationalen Kunstausstellung in Rom vertreten, 1913 folgten Aufenthalte in der Schweiz und in Berlin.
Das künstlerisch erfolgreichste Jahr war 1914. Laage besucht Paris, Antwerpen und Graubünden, darüber hinaus wurde ihm der Villa-Romana-Preis Florenz verliehen, außerdem der Ehrenpreis der Stadt Leipzig und die Staatsmedaille auf der Internationalen Graphik-Ausstellung (ebenfalls in Leipzig).
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges folgten ab 1919 wieder regelmäßige Malaufenthalte in Cuxhaven und Altenwalde. Seine letzten Arbeiten als Holzschneider schuf Laage im Jahre 1924.
Nach heutigem Kenntnisstand umfasst sein graphisches Werk 438 Blätter, davon 417 Holzschnitte. Die letzte Atelierausstellung fand im Spätherbst 1929 statt. Am 03.01.1930 starb Laage in Ulm beim Aufbau einer Ausstellung seiner Arbeiten. Beigesetzt wurde er in Reutlingen, wo am 15.01.1945 die Grabstätte durch Bomben vernichtet wurde.
Das gesamte Frühwerk (bis 1913/14) dieses bedeutenden deutschen Frühexpressionisten, der schon unter seines Zeitgenossen als Erneuerer des Holzschnitts galt, wurzelt an der Elbmündung. Sein Schaffen als Holzschneider ist eng verknüpft mit dem Aufbruch in die Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
1987 wurde im Cuxhavener Ortsteil Duhnen der Wilhelm-Laage-Weg nach diesem bedeutenden deutschen Frühexpressionisten benannt.
In der Kunstsammlung der Stadt Reutlingen (Städtisches Kunstmuseum Spendhaus) bilden die Arbeiten Laages auf dem Sammlungsgebiet des Holzschnitts der klassischen Moderne einen Schwerpunkt. Die meisten Kupferstichkabinette in Deutschland haben die Arbeiten Laages in ihren Bestand aufgenommen. Ein Großteil des Nachlasses befindet sich in Reutlinger Privatbesitz. Angesichts der Bedeutung Laages für die Stadt Cuxhaven wurde im Juni 2002 erneut eine große Laage-Ausstellung eröffnet (überwiegend Holzschnitte), die der Cuxhavener Heimatforscher, Autor und Kunstsammler Peter Bussler initiiert hatte.
Bilder
Die_Maler beim Fachsimpeln in Altenbruch 1899.
Von links_K._O._Matthaei, Wilhelm Laage,_Eduard Euler, Friedrich Mißfeldt
Werke
Dorfwirtshaus in Altenwalde